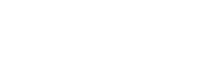Caroline Champetier
Preisträgerin des Jahres 2025

Die Regisseure, mit denen ich arbeite, gehören ganz unterschiedlichen Generationen an. Aber allen ist gemeinsam, dass sie Autoren sind. […] Das ist sozusagen meine Nische.
Caroline Champetier zu Filmbulletin
Caroline Champetier wurde am 16. Juli 1954 in Paris geboren. Da ihre Eltern strenge Vorstellungen hatten, waren Kinobesuche in ihrer Jugend eine Seltenheit – und deshalb umso prägender. Sie absolvierte ein dreijähriges Filmstudium am Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) in Paris, das heute als La Fémis zu den renommiertesten Filmschulen Frankreichs zählt. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Kameraarbeit und die Kunst der Bildgestaltung.
Von 1976 bis 1985 sammelte Champetier erste Erfahrungen als Kameraassistentin bei William Lubtchansky. In dieser Zeit war sie unter anderem an LA FEMME D’À CÔTÉ (DIE FRAU NEBENAN, 1981, R: François Truffaut), KLASSENVERHÄLTNISSE (1984, R: Straub-Huillet) sowie Claude Lanzmanns neunstündigem Dokumentarfilm SHOAH (1985) beteiligt. Rückblickend betont Champetier, wie sehr sie in dieser Phase die technische Seite der Kameraarbeit schätzen lernte.
Besonders prägend war für sie auch ihre Zusammenarbeit mit Nouvelle-Vague-Regisseur Jacques Rivette, die 1977 zunächst als Kameraassistentin bei MERRY-GO-ROUND (1980) unter der Leitung von Lubtchansky begann. Später übernahm sie selbst die Rolle als Bildgestalterin, unter anderem bei Rivettes Filmen LE PONT DU NORD (AN DER NORDBRÜCKE, 1981) und LA BANDE DES QUATRE (DIE VIERERBANDE, 1988).
Mit ihrem Debüt als Kamerafrau bei Jacques Rivettes Film LE PONT DU NORD wurde sie national bekannt und es folgten Kooperationen mit renommierten Regisseur:innen wie Jean-Luc Godard, Jacques Doillon, Benoît Jacquot und Chantal Akerman, wobei insbesondere die Arbeit mit Godard Champetier nachhaltig beeinflusste. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählt der vielfach ausgezeichnete DES HOMMES ET DES DIEUX (VON MENSCHEN UND GÖTTERN, 2010, R: Xavier Beauvois), der das Leben von Trappistenmönchen in Algerien eindrucksvoll schildert, die durch eine islamistische Terrorgruppe bedroht wird. Der Film gewann nicht nur den Großen Preis der Jury bei den Filmfestspielen in Cannes, sondern brachte Champetier auch den César für die beste Kamera ein (2011).
Besondere Anerkennung fanden zudem ihre Arbeiten mit Regisseur Leos Carax, darunter TOKYO! (2008), HOLY MOTORS (2012), ANNETTE (2021) und C’EST PAS MOI (2024). Für ihre herausragende Kameraarbeit bei diesen Filmen wurde sie mehrfach nominiert und ausgezeichnet. Für ANNETTE erhielt Champetier den Prix Lumières und die Bildgestaltung von HOLY MOTORS wurde auf der Camerimage mit dem Silbernen Frosch sowie dem Preis für die beste Bildgestaltung beim Chicago International Film Festival gewürdigt. Auch wenn es sich bei den Filmen Champetiers zumeist um französischsprachige Produktionen handelt, etablierte sie sich auch außerhalb Frankreichs als erfolgreiche Bildgestalterin. So übernahm sie Mitte der 1990er Jahre beispielsweise die Kameraarbeit bei britischen und US-amerikanischen Dokumentationen, darunter HOWARD HAWKS: AMERICAN ARTIST (1997), ein Projekt mit dem Oscar-prämierten Regisseur Kevin Macdonald. Heraussticht zudem ihre Zusammenarbeit mit Margarethe von Trotta bei dem biografischen Drama HANNAH ARENDT (2012) und zuletzt der gemeinsam mit Thomas Napper realisierte WIDOW CLICQUOT (DIE WITWE CLICQUOT, 2023).
Bei einigen Projekten hat Champetier zudem selbst Regie geführt. Dazu zählen mehrere Kurzfilme, einzelne Episoden von Fernsehserien, Dokumentarfilme für das französische Fernsehen sowie der TV-Spielfilm BERTHE MORISOT (2012). Im Laufe ihrer Karriere hat Champetier die Bildgestaltung für über 140 Spiel- und Dokumentarfilme sowie Serien übernommen. Ihre Fähigkeit, sich visuell stets neu auszudrücken, macht sie zu einer der vielseitigsten Kamerafrauen Europas.
Diese herausragende Vielseitigkeit wurde 2023 mit der Verleihung der Berlinale Kamera bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin gewürdigt. Von 2009 bis 2012 war sie Präsidentin der AFC (Association Française des directrices et directeurs de la photographie Cinématographique), in der sie auch heute noch aktives Mitglied ist. Seit 2012 beaufsichtigt sie die Restaurierungen des Why Not Katalogs.
Caroline Champetier prägt seit mehr als 40 Jahren das europäische und insbesondere französischsprachige Kino wie kaum eine andere Bildgestalterin. Dabei schlägt sie eine Brücke zwischen Filmschaffenden der französischen Nouvelle Vague wie Jean-Luc Godard, Jacques Rivette und François Truffaut, an deren Arbeiten sie in den 1980er und 1990er Jahren als Kameraassistentin und DOP mitwirkte, und einer neuen Generation von Filmschaffenden und insbesondere weiblichen Regisseurinnen wie Christine Angot, Anne Fontaine und Ounie Lecomte. Mit einigen Filmschaffenden hat sie im Laufe ihrer Karriere besonders häufig zusammengearbeitet: Xavier
Beauvois, Leos Carax, Jacques Doillon, Philippe Garrel, Benoît Jacquot. Hervorzuheben ist ebenso ihre Zusammenarbeit mit dem Kameramann William Lubtchansky. Gemeinsam mit ihm hat sie ihren ersten Spielfilm LE PONT DU NORD (AN DER NORDBRÜCKE, 1981, R: Jacques Rivette) realisiert und war eine seiner Kameraassistentinnen bei Claude Lanzmanns SHOAH (1985), bevor sie bei Lanzmanns späteren Filmen SOBIBÓR, 14 OCTOBRE 1943, 16 HEURES (2001) und LE DERNIER DES INJUSTES (DER LETZTE DER UNGERECHTEN, 2013) selbst als DOP fungierte. Lanzmanns Dokumentarfilme über den Holocaust können insofern als Fixpunkte im Schaffen Champetiers gelten, als dass sie sich auch in ihren anderen Arbeiten stets einen dokumentarisch anmutenden Blick bewahrt – einen Blick, der die beobachtende Distanz bevorzugt, der in langen Einstellungen zum Ausdruck kommt und versucht, das Geschehen in Gänze zu erfassen und nicht vorschnell einzugreifen.
Die Kameraarbeiten Champetiers scheinen somit zunächst einmal in der Tradition eines sozialen Realismus zu stehen. Deutlich wird das daran, dass viele ihrer Filme auch Milieustudien sind. So handelt es sich bei LE PETIT LIEUTENANT (EINE FATALE ENTSCHEIDUNG, 2005, R: Xavier Beauvois) um eine präzise Schilderung des Pariser Polizeialltags, während DES HOMMES ET DES DIEUX (VON MENSCHEN UND GÖTTERN, 2010, R: Xavier Beauvois) sich dem Leben französischer Mönche in einer algerischen Gemeinde widmet. Die sich in beiden Fällen wiederholenden Rituale wie die gemeinsame Einsatzbesprechung oder das Gebet fängt Champetier häufig zwischen halbtotalen und halbnahen Einstellungen ein, wobei sie auf lange und gerade im letzten Fall statische Kameraeinstellungen zurückgreift. Hinzu kommen behutsame Kameraschwenks und Parallelfahrten, die den Bewegungen der Figuren zumeist aus sicherer Distanz folgen. In diesem Zuge kann es passieren,
dass Bäume den Blick auf die Figuren versperren oder durch Glastüren und Fensterscheiben hindurch gefilmt wird, die als visuelle Markierungen im Bild die Distanz zwischen den Zuschauenden und der filmischen Handlung unterstreichen. Im Kontrast dazu steht Champetiers Wechsel zu der Arbeit mit einer beweglichen Handkamera, die in beiden Filmen das Geschehen nicht nur dynamisiert, sondern auch von einer bevorstehenden Bedrohung zeugen kann. In LE PETIT LIEUTENANT sitzt die Handkamera dem jungen Polizisten beim Aufsuchen eines Verdächtigen ebenso im Nacken wie einem der Mönche in DES HOMMES ET DES DIEUX auf seinem abendlichen Weg durch das Kloster. Beide werden kurz darauf angegriffen und ihr Leben gerät aus den Fugen.
Erahnen lässt sich daran bereits, dass es bei Champetier nicht um einen selbstzweckartigen Dokumentarismus geht. Vielmehr handelt es sich um eine Grundhaltung, von der aus sie sich jedem ihrer Filmprojekte aufs Neue nähert und vor deren Hintergrund sich ihre bildgestalterische Arbeit entfaltet. Deutlich wird das mit TOUTE UNE NUIT (EINE GANZE NACHT, 1982; Chantal Akerman) schon in einem ihrer ersten Filme. Neben den auch hier langen und häufig statischen Kameraeinstellungen, die im Zuge einer Nacht unterschiedliche Menschen dabei beobachten, wie sie sich treffen, kennenlernen und wieder auseinandergehen, gibt es auch artifiziell wirkende Tableaus. Zu beobachten etwa anhand eines Mannes und einer Frau, die in einer Bar nebeneinander an zwei getrennten Tischen sitzen und durch den auffallend symmetrischen sowie bipolaren Aufbau des Bildes voneinander separiert werden. Auf diese und andere Weisen lässt Champetier die filmische Form immer wieder punktuell in den Vordergrund treten, um einem bestimmten Gefühl oder einem Bewusstseinszustand ihrer Figuren Ausdruck zu verleihen. Dazu gehören die Überblendungen in ALICE ET MARTIN (ALICE UND MARTIN, 1998, R: André Téchiné) vom Protagonisten auf sein jüngeres Ich und seinen verstorbenen Vater ebenso wie die Hände der Pianistin vor ihrem vermeintlich letzten Konzert in VILLA AMALIA (2009, R: Benoît Jacquot), die in Zeitlupe zu erstarren drohen.
Die Kameraarbeiten von Caroline Champetier lassen sich nicht ohne Weiteres kategorisieren, sondern trotzen bei genauerem Hinsehen rasch Dichotomien zwischen einer vermeintlich realistischen und einer formalistischen Bildsprache. Ihr Schaffen zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich die gesamte Bandbreite an bildgestalterischen Möglichkeiten in ihren Filmen virtuos zu Nutzen macht. Daher ist der beobachtende Blick ihrer Kamera auch nie End-, sondern stets Ausgangspunkt für filmische Erkundungen, die Licht, Farbe, Kamerabewegungen und -effekte nutzen, um Realität zu transformieren und filmisch erfahrbar zu machen. Vor diesem Hintergrund erscheint es weniger verwunderlich, dass dem kleinen Mädchen am Ende von PONETTE (1996, R: Jacques Doillon), ein Film, der nur Augen für die Welt der Kinder hat, doch noch leibhaftig die verstorbene Mutter zum Gespräch und finalen Abschied erscheint. Auch der Weg von Lanzmann und Akerman hin zu ihrer Zusammenarbeit mit Leos Carax erscheint nicht etwa als Bruch oder radikaler Stilwechsel. Vielmehr entpuppt sich auch ein Musical wie ANNETTE (2021) mit seinen Rückprojektionen, Mehrfachbelichtungen und hervorstechenden Primärfarben im Kern als eine Studie der Kunst- und Unterhaltungsindustrie sowie toxischer Maskulinität, die Champetier in den für sie typischen langen Einstellungen und in diesem Falle zudem mit einer besonders beweglichen Kamera entwirft.
Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin erhielt Caroline Champetier 2023 die Berlinale Kamera für ihr Lebenswerk. Diese Auszeichnung krönt vorläufig die beeindruckende Karriere einer Kamerafrau, die noch lange nicht ans Aufhören denkt und bereits an einer Vielzahl weiterer Projekte arbeitet. Die Verleihung des Marburger Kamerapreis an sie versteht sich daher auch nicht als eine abschließende Geste, sondern als eine besondere Würdigung mit Blick auf ihr bisheriges Schaffen. Es ist das Werk einer mutigen Bildgestalterin, die es auf einzigartige Weise versteht, sich
immer wieder neu zu erfinden und dabei jedes Mal treu zu bleiben. Die Filme von Caroline Champetier verdienen es allerdings nicht nur ausgezeichnet zu werden. Vielmehr fordern sie in ihrer anhaltenden Aktualität zur ausgiebigen Diskussion über den Holocaust beispielsweise ebenso auf wie über die Rolle von Frauen vor und hinter der Kamera. Für diesen Dialog bieten ihnen die Bild-Kunst-Kameragespräche den gebührenden Rahmen. Hier wird das Schaffen von Caroline
Champetier auf eine Weise ins Rampenlicht gesetzt, die den Blick schärft für die stilistische Bandbreite der Filme und dem immerwährenden Drang ihrer Bildgestalterin nach neuen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten.